E-Learning-Forschung
Welche Potenziale und welche Grenzen haben digitale Medien beim Erwerb, der Vermittlung und der Kommunikation von Wissen? Im e-teaching.org-Themenspecial geht es darum, welchen Beitrag die Wissenschaft zur Beantwortung solcher Fragen leisten kann.
28.04.2014 - 14.07.2014
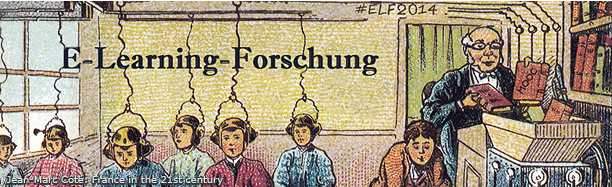
Welche Potenziale und welche Grenzen hat das Lernen mit digitalen Medien? Wie beeinflusst die Gestaltung von medialen Lernumgebungen das Lernverhalten?
Im Themenspecial geht es darum, welchen Beitrag die Wissenschaft zur Beantwortung solcher Fragen leisten kann – und darum, was Forschung für die E-Learning-Praxis bringt. Dabei werden zum einen unterschiedliche Forschungsansätze vorgestellt: Welche empirischen Methoden eignen sich, um die eigene Lehre zu verbessern oder um grundsätzliche lerntheoretische Fragen zu untersuchen? Zum anderen werden natürlich auch Forschungsergebnisse vorgestellt, z.B. zur Gestaltung von Medien und Lehrszenarien oder zur Zusammenarbeit in virtuellen Lernumgebungen.




