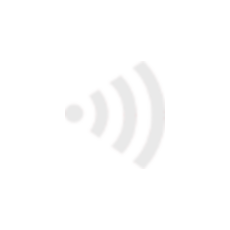Vermittlung propädeutischer Grundlagen als Teil der Qualitätsdebatte
28.04.2022: In propädeutischen Veranstaltungen erwerben Studierende Grundlagen, die zur Bewältigung des Studiums nötig sind. Insbesondere bei Studienanfängern und -anfängerinnen sind Selbstlernkompetenzen und motivationale Voraussetzungen allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. Dass sich Qualität von Hochschullehre in diesem Zusammenhang daran bemisst, inwiefern sie die Studierenden zur Bewältigung dieser initialen Herausforderung befähigt und welche Lernarrangements zur Qualitätsverbesserung beitragen, besprechen wir im e-teaching.org-Podcast mit Severin Werner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn.
Die Einstiegsphase des Hochschulstudiums ist richtungsweisend für die akademische Laufbahn von Studierenden. Im ersten Studienjahr sollen sie insbesondere die propädeutischen Grundlagen ihres Studienfachs erlernen und internalisieren, welche notwendig für Studien- und Prüfungsleistungen und Abschlussarbeiten sind. Dazu werden ausgeprägte Selbstorganisations- und Selbstlernkompetenzen sowie Kompetenzen im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens vorausgesetzt, die jedoch gar nicht alle angehenden Studierenden haben. Diese starten mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen ins Studium; der Studieneinstieg kann für sie eine große Herausforderung darstellen. Die Qualität von Hochschullehre bemisst sich in diesem Zusammenhang daran, inwiefern sie die Studierenden zur Bewältigung dieser initialen Herausforderung befähigt.
Severin Werner (M.Ed.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn. Im Interview mit Jessica Kathmann berichtet er über die Herausforderungen, die mit der zunehmenden Verlagerung von propädeutischen Lerninhalten ins Selbststudium und den unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten der angehenden Studierenden einhergehen und welche Chancen die Lernendenzentrierung sowie digital gestützte Lehre in diesem Kontext bieten.
Beitragende
Severin Werner (M.Ed.) studierte bis 2019 Englisch und Geschichte an der Universität Bonn. Anschließend legte er das zweite Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen ab. Seit 2021 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Mehr anzeigen