LectureLab
LectureLab: Lehr-Lernexperimente zur Wirkung von Feedback in WaveLAN-unterstützten interaktiven Vorlesungen
18.11.2004
Archivierter Portalinhalt
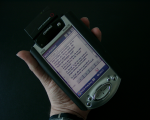
Im Zentrum des Projektes steht die Untersuchung und Optimierung des neu
entwickelten Lehr-/Lern-Szenarios der interaktiven Vorlesung. In diesem
Szenario erlauben
Wave-LAN
-unterstützte Kommunikations- und Lerntechnologien den
Studierenden und dem jeweiligen Dozierenden, während einer Vorlesungseinheit
Rückmeldungen zu Vorlesungsinhalten und zum Vorlesungsverlauf zu geben. Die
Herstellung von
Interaktivität
soll Lernvorteile für Studierende bewirken und dem
Dozierenden eine Anpassung seines Verhaltens an das Wissen und die
Beurteilungen der Studierenden ermöglichen.
Im pädagogisch-psychologischen Teil des Projektes werden aufbauend auf
empirischen Befunden zur Feedbackforschung experimentelle Felduntersuchungen
durchgeführt, in denen unterschiedliche Aspekte des Dozierenden-Feedbacks in
Rückmelderunden zur Wissensabfrage variiert werden (z.B. der
Elaborationsgrad).
Im informatischen Teil des Projektes werden die Software-Werkzeuge für die
WaveLAN-unterstützten interaktiven Kommunikations- und Lernanwendungen
entworfen, implementiert, praktisch erprobt und optimiert.
Ziele und Inhalte
Die Vorlesung als Lehrmethode unter den Bedingungen deutscher
Universitäten hat eine Reihe von Nachteilen gegenüber anderen
Lehrformen. Ihr Hauptnachteil besteht in der geringen oder gänzlich
fehlenden Interaktivität. Durch den Einsatz von Funktechnologien soll
die Interaktivität in geeigneter Weise gesteigert werden, indem bei Studierenden
Aufmerksamkeit und Motivation und im Ergebnis der Wissenserwerb
gefördert werden.
Bisher wurden interaktive Vorlesungen an der Universität in den
Fachbereichen Informatik und Erziehungswissenschaft eingesetzt.
Prinzipiell ist eine Nutzung der Technologie zur Durchführung
interaktiver Vorlesungen jedoch in allen Fachbereichen möglich, sofern
die jeweiligen Wissensinhalte in Vorlesungsform vermittelt werden und
die Hörerschaft umfangreich ist ("Massenveranstaltungen").
Didaktisches Konzept
Konventionelle Vorlesungen sind mit den didaktischen Problemen fehlender Interaktivität und geringer Adaptivität verbunden. Neue Funktechnologien erlauben in Vorlesungen eine bidirektionale synchrone Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernenden, so dass nun die Möglichkeit besteht, Interaktivität und Adaptivität auch in Vorlesungen zu realisieren.
Abb.: Studierende mit PocketPCs während einer interaktiven Vorlesung
Hierzu werden Studierende mit mobilen Rechnern ausgestattet und durch WaveLAN-basierte Dienste (z.B. Wissenstest, Zwischenfragen und Verlaufsevaluation) aktiv in das Vorlesungsgeschehen einbezogen.
Abb.: Beispiele für Fragen an die Studierenden während einer Vorlesung
Es werden querschnittlich-repräsentative Meinungs-, Stimmungs- und Wissensabbilder der Studierenden erfasst und an den Lehrenden vermittelt, so dass dieser adaptiv reagieren kann. Die Studierenden ihrerseits erhalten kontinuierlich Leistungsfeedbacks zu den eingesetzten Wissenstests.
Abb.: Stimmungsbild-Abfrage während einer Vorlesung
Hinweise zu
Vorlesungen
und begleitende Diskussionen finden Sie in der Rubrik Lehrszenarien. Der
Bereich Mediengestaltung gibt Ihnen weitere Informationen zu
Interaktivität.
Curriculare Verankerung
Interaktive Vorlesungen werden seit dem Wintersemester 2001/2002 regelmäßig an der Universität Mannheim durchgeführt. Bereits drei Mal wurde die Informatikvorlesung "Rechnernetze" interaktiv gestaltet; die erziehungswissenschaftliche Vorlesung "Pädagogische Psychologie" wird aktuell zum zweiten Mal interaktiv umgesetzt.
Technik
Zugang
Freier
Download
der
Tools unter der o.g. Webadresse.
Nutzung
Die "LectureLab"-Software sieht eine Vernetzung zwischen einem
Server
(i.d.R. dem Rechner des Dozenten) und einer Vielzahl von mobilen
Geräten, die von den Studierenden verwendet werden, vor. Diese Vernetzung
wird über
Wireless LAN
hergestellt, dadurch ist keine Verkabelung oder sonstige Vorbereitung in den
Hörsälen notwendig.
Die Kommunikation zwischen den
Clients
der Studierenden
und dem Server geschieht über ein proprietäres, ressourcenschonendes
Protokoll, das über
TCP
-Verbindungen läuft. Auf Serverseite werden alle Daten im
XML
-Format abgelegt und sind somit leicht portierbar.
Zur Zeit bietet die
Software
drei Interaktionsmöglichkeiten: Call-In (Zwischenfragen während
der Vorlesung, werden dem Dozierenden in der Software auf Abruf
bereitgestellt), Quiz (Quizrunden, um den gerade behandelten Stoff
abzufragen und so festzustellen, ob alles verstanden wurde) sowie Feedback
(kontinuierliches Feedback in verschiedenen Kategorien, mit dem Studierende
auf die Vorlesung einwirken können). Weitere Interaktionsmöglichkeiten
können dank der modularen Struktur der Software mit moderatem
Programmieraufwand selbst ergänzt werden.
Benötigte Software
An Software werden lediglich eine aktuelle
Java
Laufzeitumgebung (1.4.0 und höher für den Server, 1.1.8 für die
Studierendenclients) sowie die LectureLab-Software benötigt. Die
Client-Software ist sehr klein und zieht sich alle notwendigen oder
aktualisierten Klassen selbstständig vom Server. Werden PocketPCs als
Studierendenclients eingesetzt muß ggf. auf eine kommerzielle Java-Umgebung
zurückgegriffen werden.
Entwicklung
Die Software ist komplett Java-basiert, entsprechend kamen bei der
Entwicklung das Java Software Development Kit (Java2-SDK) von Sun zum
Einsatz. Zur Speicherung der Daten und zur serverseitigen Kommunikation wird
XML verwendet.
Kosten
Gegebenenfalls ist die Anschaffung von PocketPCs für die Studierenden notwendig; diese kosten ca. 300-500 Euro pro Stück; Studierende können aber, falls vorhanden, eigene mobile Endgeräte verwenden. Darüber hinaus ist ein handelsüblicher Mittelklasse-Laptop als Server und ein Access Point (ca. 50 Euro) notwendig. Infrastrukturelle Änderungen an den Hörsälen müssen nicht vorgenommen werden. Jegliche benötigte Software ist frei verfügbar. Je nach dem, wie intensiv das System genutzt wird, muss dem Dozierenden durch eine Hilfskraft oder einem Mitarbeiter assistiert werden.
Zielgruppe
Das Ziel des Projekts "LectureLab" ist nicht inhaltlicher, sondern prozessualer und struktureller Natur. Das Szenario kann in beliebigen Fachbereichen realisiert werden und zielt auf eine höhere Motivierung, Aufmerksamkeit und größeren Lernerfolg auf Studierendenseite in Vorlesungen ab. Eine Eignung ist daher für alle Zielgruppen gegeben, bei denen Wissensinhalte frontal (durch Vorlesungen) vermittelt werden sollen.
Rahmenbedingungen
Jeder Kurs mit mehr als 30 Studierenden kann von dem System profitieren; spezielle Räume sind nicht notwendig.
Ergebnisse
Bisher wurden insgesamt sieben quasiexperimentelle Untersuchungen in
den betreffenden interaktiven Vorlesungen durchgeführt. Die Ergebnisse
zeigen generell eine hohe Akzeptanz des Szenarios bei den Studierenden
sowie eine gesteigerte Lernwirksamkeit durch die interaktiven Elemente.
Zudem entstanden zwei Magisterarbeiten im Rahmen des Projektes.
Zum Projekt
Website
http://www.lecturelab.deAnsprechpartner/in
Pädagogisch-psychologischer Bereich:
Dipl-Psych. Anja Wessels, E-Mail:
wessels@uni-mannheim.de, Tel. 0621-181/3573
Informatischer Bereich:
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Nicolai Scheele, E-Mail:
scheele@lecturelab.de, Tel: 0621-181/2604
Zeitraum
Förderung
Beteiligungen und Kooperationen
Das Projekt "LectureLab" wurde 2003 gemeinsam durch die Lehrstühle der Universität Mannheim für Erziehungswissenschaft II (Pädagogische Psychologie) und Praktische Informatik IV initiiert. Die Dauer des Kooperationsprojektes, welches von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird, beträgt zwei Jahre.
Kategorisierung
Lehrfunktion
- Informationsvermittlung
- Üben u. Anwenden
- Diskussion u. Austausch
- Motivation
- Feedback u. Lernerfolgskontrolle
Medieneinsatz
- Sonstigs
Fachbereich
- Sonstiges
Lehrszenarien
- Vorlesung
- Übung
Kategorie
- Software
